https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
A: Zellen - Bausteine des Lebens
Zellen von Tieren und Pflanzen
Ordne die folgenden Zellarten ihren entsprechenden Funktionen zu.
- Nervenzelle
- Rote Blutkörperchen
- Weiße Blutkörperchen
- Knochenmarkzelle
- Muskelzelle
- Transport von Sauerstoff
- Weiterleitung elektr. Impulse
- Bildung von neuem Blut
- Bewegung
- Abwehr von Krankheitserregern
Bauteil
Funktion
Bauteil
Funktion
Traubenzucker + Sauerstoff => +
Vererbung
Die verschiedenen Abschnitte des DNA-Fadens heißen . Sie enthalten die .
Meist sind mehrere Gene an der Ausprägung eines , wie z.B. Hautfarbe oder Körpergröße, beteiligt.
Die DNA besteht aus zwei Strängen, die miteinander verbunden sind. Diese sind schraubig umeinandergewunden. Man bezeichnet diese Form als .
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
Chromosomen
und
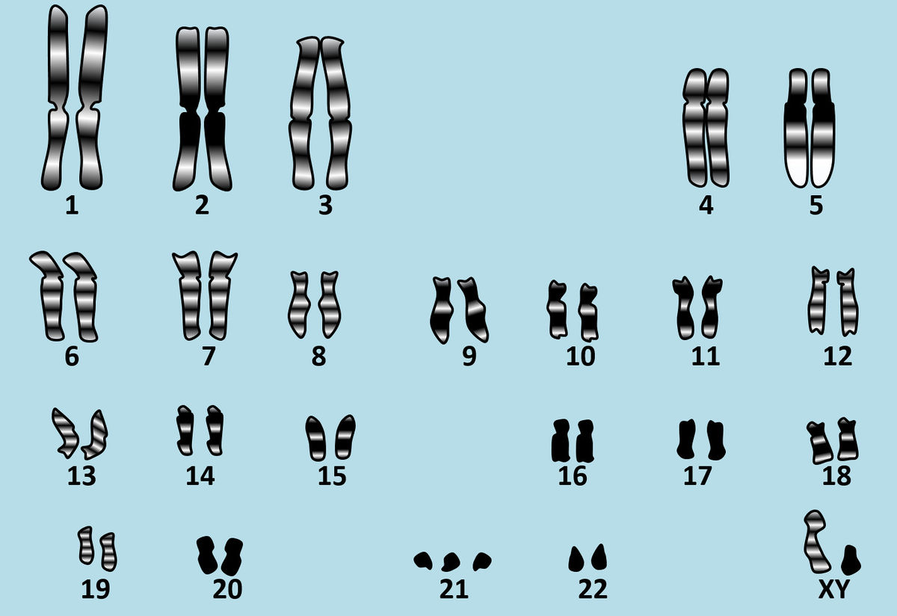
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
Veränderugen der Erbsubstanz
Dieser Fachbegriff lautet .
Genetisch bedingte Erkrankungen
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
B: Angewandte Gentechnik
Pflanzen- und Tierzucht
Genmanipuation. Nenne ein klassiches Züchtungsverfahren aus der Landwirtschaft und nenne ein konkretes Beispiel.
Gentechnik: Chancen und Risiken
Anwendungsgebiet
Vorteil
Beispiel
Fischzucht
- Tiere weniger krankheitsanfällig
- wachsen schneller
- können Futter besser verarbeiten
- Transgener Atlantischer Lachs
Medizin für Menschen
Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten
Insulin (aus transgenen Bakterien)
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
Angewandte Gentechnik beim Menschen
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
C: Radioaktivität
Entdeckung der Radioaktivität
Es heißt .
Es geht auch mit .
Strahlungsarten und Eigenschaften von Radioaktivität
Strahlungsart
Abschirmung durch
Alpha-Strahlung
Papier
Beta-Strahlung
Aluminiumplatte
Gamma-Strahlung
dicke Bleiplatte
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
Natürliche und künstliche Radioaktivität
Quelle für natürliche radioaktive Strahlung
Bodenradioaktivität/Radon/kosmische Strahlung
Quelle für künstliche radioaktive Strahlung
Röntgenstrahlung/Kernkraftwerke/Kernwaffenversuche
Nutzen und Risiko von Radioaktivität
Nenne ein Beispiel.
C-14-Methodelässt sich das Alter von verstorbenen Lebewesen bstimmen. Wofür steht
C-14?
C-14-Methodeam Beispiel der Eismumie
Ötzi.
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
D: Energieversorgung im Wandel
Energie aus dem Atomkern
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
Kernenergie nutzen
in einem Kernkraftwerk? Beschrifte korrekt mit den Zahlen 1 bis 4.
- Dampferzeugung: Das erhitzte Wasser wird zu Dampf, der unter hohem Druck steht und expandiert.
- Kernspaltung: Die Kernspaltung von Atomkernen setzt Energie frei, die in Form von Wärme umgesetzt wird.
- Wärmeübertragung: Die freigesetzte Wärme wird an ein Kühlmedium, in der Regel Wasser, übertragen und erhitzt es.
- Stromerzeugung: Der Dampf treibt eine Turbine an, die wiederum einen Generator antreibt, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.
durch Kernenergie.
Vorteile der Kernenergie
Die Kernenergie ist eine saubere Energiequelle, die keine Luftverschmutzung verursacht.
Die Kernenergie kann eine große Menge an Energie produzieren, um viele Menschen zu versorgen.
Nachteile der Kernenergie
Die Kernenergie kann gefährlich sein, wenn es zu Unfällen kommt, wie zum Beispiel einem Reaktorunfall.
Die Kernenergie produziert radioaktiven Abfall, der schwierig und teuer zu entsorgen ist.
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
E: Informationsaufnahme und -verarbeitung beim Menschen
Das Nervensystem
Das Nervensystem ist das des menschlichen Körpers.
Alle und Vorgänge in unserem Körper werden von diesem System aus Nervenzellen gesteuert.
Das Nervensystem besteht aus dem mit und sowie dem
mit den Nervenzellen.
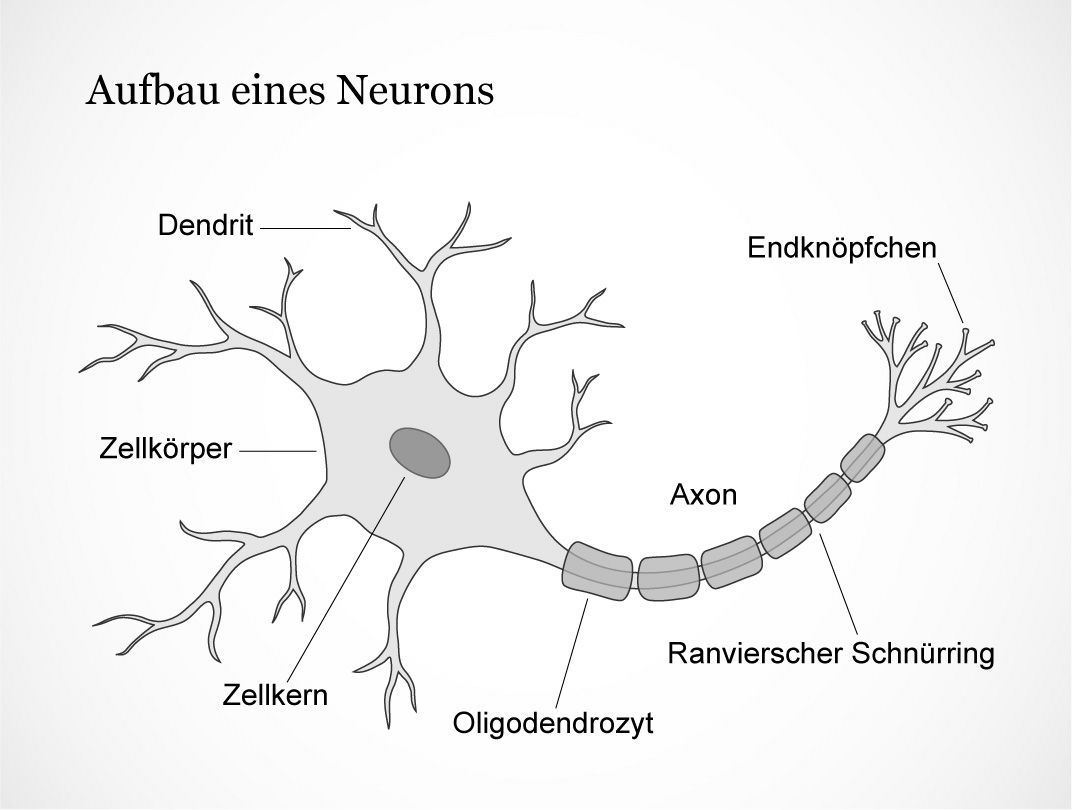
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt
Das Gehirn
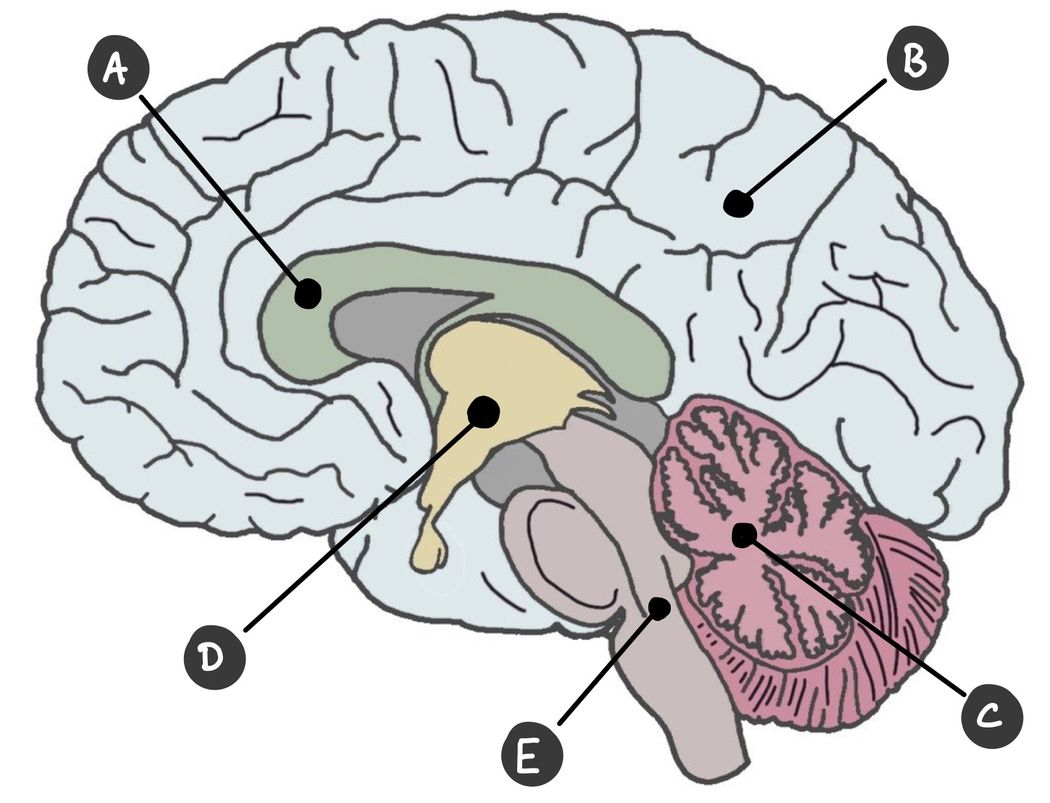
B
Großhirn
C
Kleinhirn
D
Zwischenhirn
E
Hirnstamm
https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt


